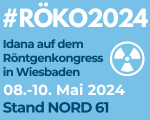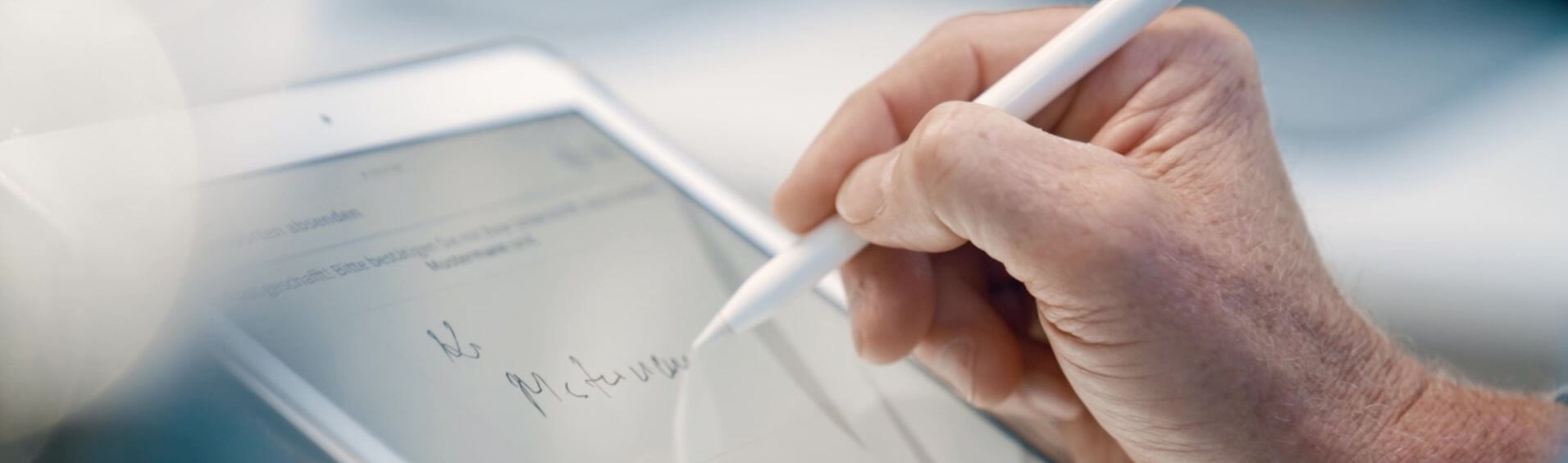
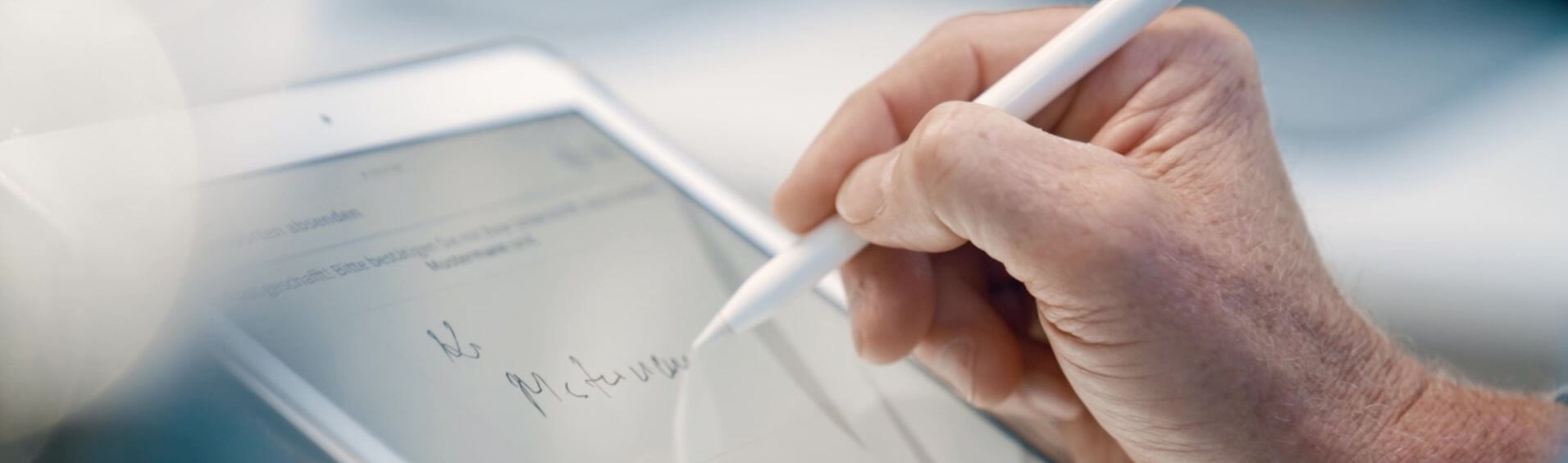
Deutscher Schmerzfragebogen
Deutscher Schmerzfragebogen
Der Deutsche Schmerzfragebogen ist ein ausführliches Inventar zur standardisierten Erhebung relevanter Schmerzmerkmale. Als der wohl gängigste Anamnesefragebogen der Schmerzmedizin in Deutschland gibt Idana Ihnen alle entscheidenden Informationen für Ihre Schmerzanamnese in digitaler Form aus.
Der Deutsche Schmerzfragebogen (DSF) zeichnet sich dadurch aus, dass er die detaillierte Schmerzanamnese in einem standardisierten Format vornimmt – und Ärzte und Ärztinnen auf dem Gebiet der Schmerzmedizin kommen kaum an ihm vorbei. So wertvoll die gesammelten Informationen auch sind – in Papierform wird die Dokumentation des DSF schnell zu einem Nervenakt. Die verschiedenen Fragenformate von Idana sowie bedingtes Fragen werden hier bestmöglich eingesetzt, um den Fragebogen für PatientInnen und Praxis gleichermaßen übersichtlich und ökonomisch zu gestalten.
→ Für Ärzte und MFA bedeutet das: weniger zeitraubende Auswertung und weniger Zeit am Scanner!
→ Für Patient/innen bedeutet das: mehr Vertrauen in die Behandlung durch maximal individualisierte Anamnese!


Was sind die Stärken des Deutschen Schmerzfragebogens?
- Validiertes und verbreitetes Instrument zur verlässlichen Schmerzanamnese
- Detaillierte und subjektive Schmerzangaben
- Der der Einsatz des DSF trägt zur Qualitätssicherung in der Schmerzmedizin bei
Zweck: Screening für neue Patient/innen sowie Verlaufskontrolle bei bekannter Symptomatik
Inhalte des Fragebogens:
- Fragen zum Schmerz (Lokalisierung, Beschreibung)
- Fragen zum psychischen Befinden (DASS-21, FW7, VR-12)
- Bisherige Behandlungen
- Medikation
- Vorerkrankungen
- Modul D: Fragen zu Demographie und Versicherung
- Modul S: Fragen zur sozialrechtlichen Situation
- Modul L: Fragen zur Lebensqualität (VR-12)
Einsatz: Analyse der Schmerzsituation bei neuen Patient/innen, sowie Planung der Schmerztherapie. Bei bereits bekannten Patienten und Patientinnen kann der Verlauf der Therapie verfolgt und ggf. angepasst werden.
Fachbereiche: Schmerzmedizin
Bearbeitungszeit Patient: 50 Minuten
Wissenschaft:
- Hohe Inhaltsvalidität
- Von ExpertInnen entwickelt
- integriert validierte Messinstrumente zu psychischen Variablen
Alternative Fragebögen:
- Schmerz-Verlaufsbogen
- Schmerzfragebogen zum Behandlungsbeginn
- PainDETECT
- Schmerz-Tagesprotokoll
Ergänzende Fragebögen:
- MPSS (Schmerzchronifizierung)
Besondere Inhalte und Funktionen:
Bedingte Fragen für ein ökonomisches Instrument, Hervorhebung wichtiger Antworten durch Red Flags im Arztbericht, automatische Berechnung von Scores (BMI, DASS-21, VR-12), Freitext-Felder für individuelle Schmerzbeschreibungen, einfache Schmerzlokalisation durch “Einzeichnen”-Funktion auf mehreren Illustrationen des Körpers, visuelle Analogskalen zur Angabe der Schmerzintensität
Inhalte des Deutschen Schmerzfragebogens im Detail erklärt
Fragen zum Schmerz
Wie, wo, (seit) wann, warum: Alle wichtigen W-Fragen, die bei einer Erstanamnesen eine Rolle spielen, werden gleich zu Beginn gestellt. So kann der Patient bzw. die Patientin als erstes die Schmerzen über lokalisieren und auf den bekannten Grafiken des DSF einzeichnen. Das klappt sogar am Smartphone ohne Probleme! Zur Abfrage des Schmerzbeginns, des zeitlichen Verlaufs sowie der Schmerzintensität stehen neben festen Antwortmöglichkeiten (“seit weniger als 1 Monat” oder “Seit 1 bis 2 Jahren”) auch Freitextfelder für Patientenangaben (“Mein Schmerz fühl sich morgens immer ganz anders an als abends”) oder visuelle Analogskalen (Schmerzintensität auf einer Skala von 1 – 10) zur Verfügung.
Über die Schmerzbeschreibungsliste (SBL; Korb & Pfingsten, 2003) wird eine qualitative Darstellung des Schmerzes ermöglicht, die differentialdiagnostisch bereits Hinweise auf gewisse Schmerzsyndrome liefern kann. Außerdem wird die Dimension des affektiven Schmerzerlebens abgebildet, das gerade bei langjährigen Schmerzerleben von großer Bedeutung ist und psychosomatische Auswirkungen haben kann.
Fragen zum psychischen Befinden
Mit 7 Fragen erfasst der FW7 (Herda, Scharfenstein & Basler, 1998) das habituelle Wohlbefinden. Die Skala ist änderungssensitiv und eignet sich zur Verlaufskontrolle nach Interventionen zur Verbesserung des Wohlbefindens (Basler, 1999). Im Gegensatz zu DASS-21, die symptomorientiert ist, sind die Fragen des FW7 positiv formuliert und zielen eher auf das Wohlbefinden ab, das PatientInnen trotz ihres Schmerzes noch empfinden können. Üblicherweise sind Wohlbefinden und Chronifizierung negativ korreliert (ebd.).
Die Depression Anxiety Stress Scale (DASS) untersucht die Belastungssituation der PatientInnen mit 21 Fragen und unterscheidet dabei zwischen Depression, Angst und Stress. Hier haben wir Ihnen einige Informationen zum DASS-21 zusammengestellt.
Schließlich wurde auch der VR-12 (Kazis et al., 2004) zur Erfassung von Einschränkungen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität in den DSF integriert. Mit je einem Score für die körperliche und psychische Gesundheit lässt sich damit ein gutes Urteil über Einschränkungen im Alltag und psychische Belastung treffen.
Bisherige Behandlungen
Bei erstmaliger Vorstellung ist es selbstverständlich unabdingbar zu erfahren, welche Maßnahmen bisher unternommen wurden, um die Schmerzen zu behandeln. Daher werden nicht nur bisherige Behandler und Diagnosen abgefragt, sondern auch die konkreten Behandlungen. Dazu steht den PatientInnen eine lange Liste an Behandlungen mit Antwortmöglichkeiten wie “Infusionen”, “Krankengymnastik” oder “ Elektrische Nervenstimulation (TENS)” zur Verfügung, aus der sie alle Behandlungen auswählen und ergänzen können. Zusätzlich wird eine Einschätzung der Wirksamkeit jeder Maßnahme erfragt, sowie bisherige Operationen und deren Verbindung zu den aktuellen Schmerzen.
Medikamente
Sie erhalten einen Überblick über alle aktuell und früher bereits eingenommenen (Schmerz-) Medikamente sowie deren Wirksamkeit und mögliche Nebenwirkungen, die nach der Einnahme aufgetreten sind. Auch Allergien und Unverträglichkeiten gegen Medikamente können von PatientInnen an dieser Stelle angegeben werden.
Vorerkrankungen
Diese Sektion übermittelt das Vorliegen von Krankheiten oder Krankheitsfolgen zahlreicher Organe und physiologischer Strukturen und die Beeinträchtigung durch diese im Alltagsleben. Nicht vernachlässigt werden außerdem weitere Allergien oder Risikofaktoren (wie Infektionen oder Blutgerinnungsstörung), die der Patient bzw. die Patientin in einem Freitextfeld angeben kann.
Modul D: Fragen zu Demographie und Versicherung
Sofern der Praxis noch nicht bekannt werden hier versicherungsbezogene Informationen wie Adress- und Kontaktdaten, sowie Nationalität und Muttersprache erhoben. Ebenfalls wichtig für einen reibungslosen Ablauf der Therapie ist die Kenntnis von überweisender Praxis und weiteren laufenden Behandlungen bei anderen Fachärzten oder Fachärztinnen und Psychotherapeut/innen. Versicherungstechnische Zusatzinformationen wie eine Beihilfe-Berechtigung oder das Vorliegen einer Krankentagegeldversicherung werden ebenfalls erfragt.
Modul S: Fragen zur sozialrechtlichen Situation
Die Situation von Berufstätigen und Nicht-Berufstätigen wird näher beleuchtet auf das Vorliegen einer Berufsunfähigkeit oder Berentung und deren konkrete Ausgestaltung – seit wann besteht die AU? Ist eine Rückkehr zum Arbeitsplatz wahrscheinlich? Wird Rente bezogen, wurde ein Renten-Antrag gestellt, läuft derzeit ein Widerspruchsverfahren? Es entsteht ein äußerst detailliertes Bild der sozialrechtlichen Situation des Patienten bzw. der Patientin, die im Übrigen durch bedingte Fragen immer nur die nötigen und relevanten Fragen gestellt bekommen.
Einsatz Deutscher Schmerzfragebogen
Die Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung chronisch schmerzkranker Patienten der Kassenärztlichen Vereinigung sieht in der schmerztherapeutischen Versorgung eine standardisierte Dokumentation jedes Behandlungsfalls vor, darunter fallen Eingangserhebung und Verlaufskontrolle, die mit dem DSF hervorragend durchführbar sind. Der DSF erfüllt alle Anforderungen der Qualitätssicherungsvereinbarung.
Die Deutsche Schmerzgesellschaft engagiert sich zudem weiterhin in der Qualitätssicherung und versucht mit der Initiative KEDOQ-Schmerz die Kerndokumentation und Qualitätssicherung im schmerzmedizinischen Bereich voranzutreiben. Mithilfe des DSF werden schmerzrelevante Daten aller teilnehmenden schmerztherapeutischen Einrichtungen gesammelt, um die Versorgungssituation von SchmerzpatientInnen besser abbilden zu können.
Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie empfiehlt bei der Diagnose neuropathischer Schmerzen den DSF als zusätzlichen Fragebogen zur multidimensionalen Erfassung des Schmerzes, also auch unter dem Aspekt psychischer Erkrankungen, der Lebensqualität und der Beeinträchtigung durch die Schmerzen.
Wissenschaft Deutscher Schmerzfragebogen
Der Deutsche Schmerzfragebogen wurde entwickelt von Expertinnen und Experten des Arbeitskreises “Standardisierung und Ökonomisierung in der Schmerztherapie” der Deutschen Schmerzgesellschaft. Dabei wurde Wert gelegt auf eine zugleich äußerst detaillierte und dennoch maximal individualisierte Informationsgewinnung. In einer Validierungsstudie (2002) wurde dem Deutschen Schmerzfragebogen eine hohe inhaltliche Validität attestiert. Die große Mehrheit der Patienten und Patientinnen hatte den Eindruck, ihre Krankengeschichte bzgl. des Schmerzes werde durch den Fragebogen vollkommen abgedeckt. Fast 90 % der teilnehmenden Ärzte und Ärztinnen einer weiteren Validierungsstudie gaben an, der DSF sei hilfreich sowohl für Diagnostik als auch die darauf basierende Therapie (Handbuch).
In den DSF wurden außerdem validierte Instrumente mit jeweils guten Gütekriterien (FW7, SBL, DASS-21, VR-12) integriert, die zudem speziell für Schmerzpatienten und SchmerzpatientInnen geeignet sind.
Entdecken Sie Idana!
Wir haben Fragebögen für alle Fachbereiche.